Was diese spezielle Zeit mit mir anstellt! (2)
Lieblingsbücher sind ganz spezielle Bücher, nicht zwingend “die wichtigen”, nicht unbedingt jene, die “einen geprägt” haben, Bücher halt, die man noch mehr liebt als die anderen – und mit denen meist eine Geschichte verknüpft ist, eine Erinnerung, die eine bessere Chance hat, wieder wach zu werden in Zeiten wie dieser. Weil man die Musse hat, in den eigenen Bücherregalen auf Entdeckungsreisen zu gehen, die über das blosse Wiedersehen mit diesen speziellen Büchern hinausgeht:
OSCAR PEER: EVA UND ANTON
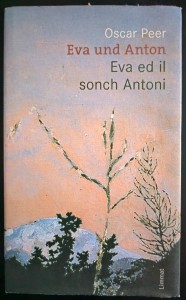 Das Gebäude war alt, langgezogen, abweisend, monumental und schien mir eher ein Gefängnis- oder Verwaltungsgebäude zu sein als eine «höhere Schule». Meine Nervosität stieg, ich wusste nicht, was mich erwartete und fühlte mich unwohl in diesem hohen, langen Flur der Kantonsschule «Im Lee» in Winterthur, wo man mich warten hiess, bis man mich rufen würde. Anders als in den anderen Abteilungen war die mündliche Aufnahmeprüfung hier ungeachtet der Vornoten obligatorisch; ich erinnere mich nur an jene im Fach Deutsch.
Das Gebäude war alt, langgezogen, abweisend, monumental und schien mir eher ein Gefängnis- oder Verwaltungsgebäude zu sein als eine «höhere Schule». Meine Nervosität stieg, ich wusste nicht, was mich erwartete und fühlte mich unwohl in diesem hohen, langen Flur der Kantonsschule «Im Lee» in Winterthur, wo man mich warten hiess, bis man mich rufen würde. Anders als in den anderen Abteilungen war die mündliche Aufnahmeprüfung hier ungeachtet der Vornoten obligatorisch; ich erinnere mich nur an jene im Fach Deutsch.
Endlich wurde ich gerufen. Das leere Schulzimmer, das ich betrat, erschien mir düster, der Lehrer, der mich gleich prüfen würde, gestreng, ernst, unzugänglich, mürrisch; der einzige Lichtblick war der Experte, der hinten im Zimmer sass: er unterrichtete in der Parallelklasse an der Sekundarschule, war mir somit bekannt.
Und da stellte der gestrenge Herr Kantonsschullehrer auch schon die erste Frage. Ich verstand sie in meiner Aufregung und weil sie mir bis heute als etwas genuschelt in Erinnerung ist, nicht vollständig. Sie lautete ungefähr so: «Verwandt mit – nuschelnuschel – Walser?»
Ich konnte wohl kaum zugeben, die Frage nicht verstanden zu haben, die allererste zudem! Doch es sprach aus mir heraus, bevor ich mir eine Antwort zurechtlegen konnte: «Mit Martin Walser nicht – mit Robert schon.» Was wiederum den vor mir Stehenden kurz aus dem Konzept brachte: Er konsultierte sein Blatt, auf dem der Name des Prüflings stand: Martin Walser. Dann lächelte er kaum wahrnehmbar, und hob, während er vor mir auf und ab ging, zu einem Loblied auf Robert Walser an. Ich glaube, ich habe lediglich zwei Fragen beantworten müssen: «Hast du etwas von ihm gelesen?» und «Hat es dir gefallen?» Fünfzehn oder zwanzig Minuten später stand ich wieder im Flur, noch verwirrter als zuvor: Wie sollte ich eine Prüfung bestanden haben, bei der gar nichts geprüft wurde?
Der Experte erschien kurz, beruhigte mich: «Kein Grund zur Besorgnis.» Und verschwand wieder.
Ich hatte bestanden.
Dass Oscar Peer auch schriftstellerisch tätig war, wusste man natürlich an der Schule, die er bald darauf verliess, gelesen hatte ich nie etwas von ihm, bis ich Jahrzehnte später in einer Buchhandlung auf eine Neuauflage in deutscher und rätoromanischer Sprache von «Eva und Anton/Eva ed il sonch Antoni» stiess. Ein wundervolles Buch, das ich bereits mehrere Male gelesen habe und nun wieder zur Hand nehme.

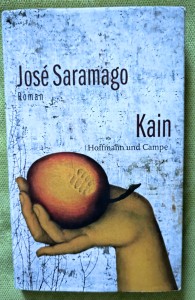 spezielle Zeit doch mit mir anstellt! Nicht, dass mich dies – länger – ängstigen würde, ich staune mittlerweile eher und, inmitten dieser Verbissenheit, dieses immer derberen Kampfes um die Richtigkeit des eigenen, des einzig wahren Standpunkts, dieser Schlacht, bei der man sich Zahlen entgegenschleudert und womit man aufeinander eindrischt, die eigene Interpretation stets parat, der unbändige Wille, sie bis zum endgültigen Sieg durchzusetzen, und daneben manche Lächerlichkeit des Alltags, die für oder wider den angeblichen Beweis von Verlust von Freiheit und Demokratie ins Feld geführt wird: Kriegsrhetorik allerorten – und schon der Triumph mitten unter uns, absehbar, durchsichtig, aber gefeiert, als habe man gesiegt: «Wir haben es schon immer gewusst», zum Beispiel, dass alles nicht so schlimm herauskäme, wie die verhasste Politik dies dargestellt habe, ergo alles falsch gewesen sei, was dieselbe verordnet und befohlen habe, ohne dass man einen einzigen Gedanken daran verschwendet, wie sich alles entwickelt haben könnte, wäre nichts von alledem, was nun im Rückblick als «übertrieben» gegeisselt wird, je ergriffen, angeordnet, geboten und verboten worden, inmitten all dessen also wage ich zu bekennen, dass ich manches von dem zu geniessen begonnen habe, was ich mit mir anstelle in einer Zeit, in der sich vordergründig die Möglichkeiten verringert haben.
spezielle Zeit doch mit mir anstellt! Nicht, dass mich dies – länger – ängstigen würde, ich staune mittlerweile eher und, inmitten dieser Verbissenheit, dieses immer derberen Kampfes um die Richtigkeit des eigenen, des einzig wahren Standpunkts, dieser Schlacht, bei der man sich Zahlen entgegenschleudert und womit man aufeinander eindrischt, die eigene Interpretation stets parat, der unbändige Wille, sie bis zum endgültigen Sieg durchzusetzen, und daneben manche Lächerlichkeit des Alltags, die für oder wider den angeblichen Beweis von Verlust von Freiheit und Demokratie ins Feld geführt wird: Kriegsrhetorik allerorten – und schon der Triumph mitten unter uns, absehbar, durchsichtig, aber gefeiert, als habe man gesiegt: «Wir haben es schon immer gewusst», zum Beispiel, dass alles nicht so schlimm herauskäme, wie die verhasste Politik dies dargestellt habe, ergo alles falsch gewesen sei, was dieselbe verordnet und befohlen habe, ohne dass man einen einzigen Gedanken daran verschwendet, wie sich alles entwickelt haben könnte, wäre nichts von alledem, was nun im Rückblick als «übertrieben» gegeisselt wird, je ergriffen, angeordnet, geboten und verboten worden, inmitten all dessen also wage ich zu bekennen, dass ich manches von dem zu geniessen begonnen habe, was ich mit mir anstelle in einer Zeit, in der sich vordergründig die Möglichkeiten verringert haben.




